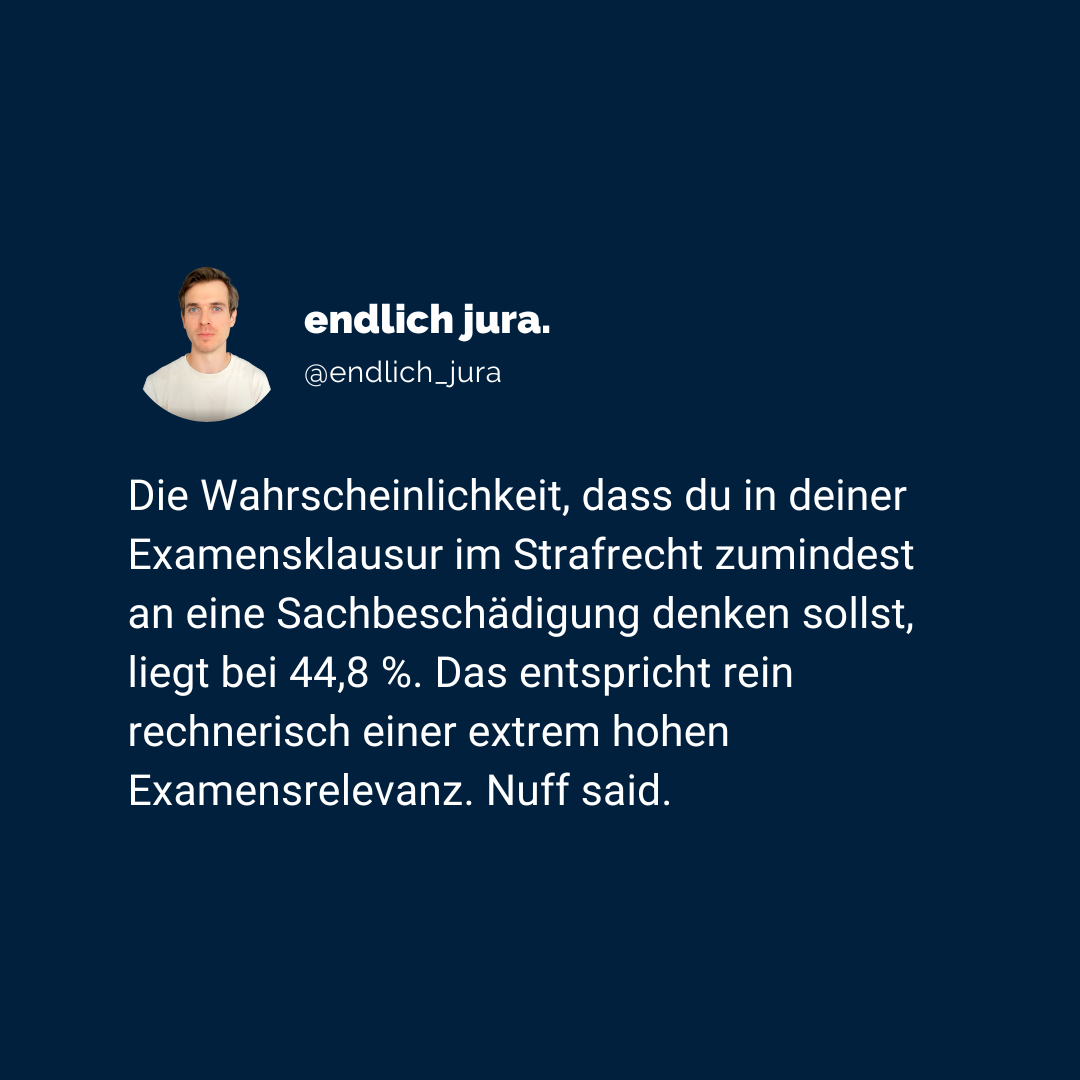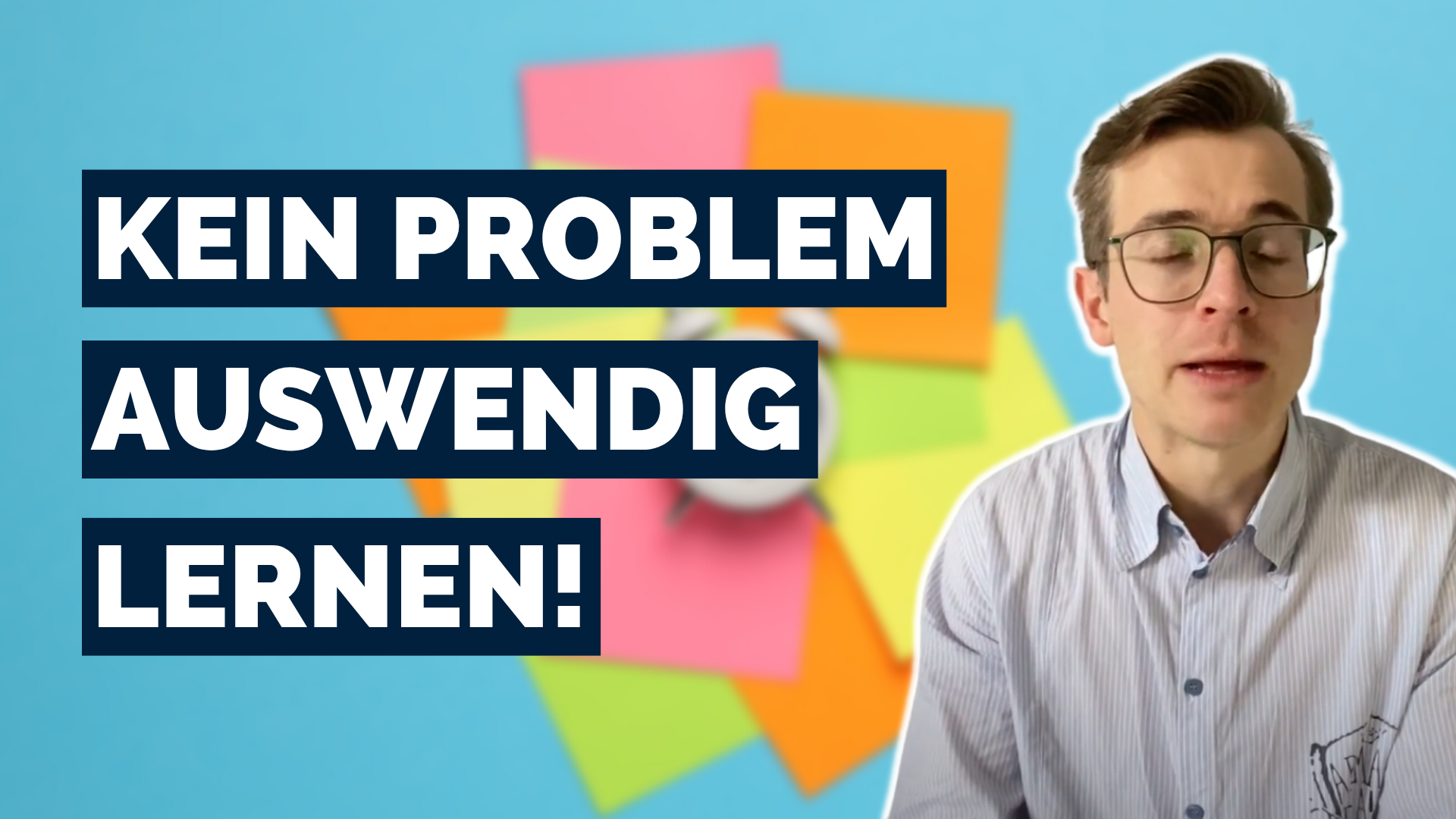JNG #323: 💡 Deine Probleme sind nicht das Problem

Lesezeit: 5 Minuten
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jura neu gedacht – heute mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen: warum du unbedingt aufhören solltest, Probleme (die keine Standardprobleme sind) auswendig zu lernen. Ich verspreche dir: Das bringt dich spätestens in der Examensvorbereitung nicht mehr weiter. Die Gründe dafür und was du stattdessen tun kannst, erkläre ich dir in diesem Beitrag.
Warum wir alle dazu neigen, Probleme zu lernen
Ich nehme mich da selbst nicht aus. Schon ab dem ersten Semester war ich wie viele von euch mittendrin: Im BGB fing alles an mit Fragen zur Existenzberechtigung von Anscheins- und Duldungsvollmacht. Später im Examen ging es um Begriffe wie »condictio ob rem« oder den Bereicherungsrechtsschutz bei der Ersitzung (meine Z-I-Klausur 🫡). Ich habe mich gefragt: Wie soll ich das alles behalten? Wie machen das die anderen?
Das Ding ist: In der Uni und im Repetitorium dreht sich fast alles um Problemfälle. Die, wie ich sie nenne, tatsächlich einfachen Fälle – also die Normalfälle, die den Regelfall darstellen – kommen viel zu kurz. Dabei wären genau diese so entscheidend, um den Blick fürs Wesentliche zu schärfen.
Was bleibt übrig, wenn du alle Probleme streichst?
Mach den Selbsttest: Nimm dir eines deiner Lehrbücher oder Skripte und streiche rigoros alle Problemdiskussionen. Du wirst feststellen: Aus einem dicken Lehrbuch wird ein dünnes Skript. Aus dem Skript ein paar Notizzettel. Und was übrig bleibt, ist das Wichtigste: die Grundstrukturen, Prinzipien und allgemeinen Regeln. Genau die brauchst du – und genau die solltest du auch lernen.
90 % der Examensklausur bestehen aus einfachen Fällen
Die Wahrheit ist: Etwa 90 % jeder Examensklausur bestehen aus tatsächlich einfachen Fällen oder: Auf neun unproblematische Prüfungspunkte folgt ein problematischer. Das bedeutet aber auch, dass die einfachen Fälle letztlich den Ausgang der Klausur bestimmen. Die restlichen 10 % sind die berühmten Probleme, die man gerne »mitnimmt«, wenn man sie erkennt – aber die oft überschätzt werden. Denn: Wer sich auf Problemwissen verlässt, ist in der Klausur schnell aufgeschmissen, sobald eins drankommt, das man noch nicht kennt.
Warum du ohne Normalfall-Wissen Probleme nicht erkennen kannst
Ein Beispiel: Jemand schreibt mit einem Edding »Bitte keine Werbung« auf einen fremden Briefkasten. Ist das eine Sachbeschädigung? Du wirst das nicht beurteilen können, wenn du nicht weißt, was der einfache, typische Fall einer Sachbeschädigung ist – etwa das Einschlagen einer Fensterscheibe. Erst, wenn du den Normalfall kennst, kannst du eine Vergleichsüberlegung anstellen (dazu sogleich). Fehlt dir dieser Referenzpunkt, bleibt nur Unsicherheit.
Die Lösung: Das Denken in tatsächlich einfachen Fällen
Auch der Jurist und ehemalige Prof Fritjof Haft betont immer wieder die Wichtigkeit des sog. »Normalfall-Denkens« – leider ohne eine genaue Anleitung zu geben, was man damit in der Klausur eigentlich anstellen kann. Ich hab’ das Ganze vor fünf Jahren mal zu Ende gedacht und ordentlich Content dazu produziert. Die Grundidee in groben Zügen: Du arbeitest dich vom tatsächlich einfachen Fall, der von der Norm eindeutig geregelt wird, häppchenweise zum Problemfall vor. Dabei gehst du in drei Schritten vor:
-
Vergleiche die Fälle: Du stellst den Normalfall (z. B. Scheibe einschlagen = Sachbeschädigung) dem Fall aus der Klausur (z. B. Briefkasten beschriften) gegenüber.
-
Bewerte die Entfernung: Ist der Klausurfall so weit vom Normalfall entfernt, dass keine Subsumtion mehr möglich ist? Oder reicht die Ähnlichkeit aus?
-
Berücksichtige Besonderheiten: Gibt es Umstände, die eine andere Bewertung rechtfertigen? Hier kommen Argumentation abseits der üblichen Pfade, Kreativität und dein Gespür für Vertretbarkeit ins Spiel.
Das Schöne: Wenn du dich am Normalfall orientierst, landest du immer bei einem vertretbaren Ergebnis. Du argumentierst sauber, logisch und nachvollziehbar. Und du machst dir das Leben leichter, weil du nicht versuchst, Dutzende Spezialprobleme auswendig zu lernen.
Beispiel aus der Praxis
Ich erinnere mich an eine Examensklausur, in der es um die Abgrenzung von Werkvertrag und Kaufvertrag mit Montageverpflichtung ging. So kompliziert, dass es dazu bei den Jura-Basics sogar einen Aufsatz von mir gibt. Heute könnte ich dir die Abgrenzungskriterien jedenfalls nicht mehr exakt herunterbeten – aber ich erinnere mich noch genau an das dahinterstehende Konzept: Es kommt auf den Schwerpunkt der geschuldeten Leistung an. Liegt dieser auf der Montage (Werkvertrag) oder auf der Lieferung (Kaufvertrag)? Dieses Verständnis trug meine Lösung – nicht ein auswendig gelernter Kriterienkatalog. Stell dir vor, du kannst diesen Katalog tatsächlich auswendig und spulst ihn in der Klausur ab, nur um dann festzustellen, dass der Fall gar nicht ausreichend Subsumtionsmaterial enthält. Du schreibst etwas wie »Je mehr die mit dem Warenumsatz verbundene Übertragung von Eigentum und Besitz an einer Sache auf den Besteller im Vordergrund steht und je weniger die individuellen Anforderungen des Kunden und die geschuldete Montageleistung das Gesamtbild des Vertragsverhältnisses prägen, desto eher ist die Annahme eines Kaufvertrages mit Montageverpflichtung geboten und somit das kaufvertragliche Mängelrecht anzuwenden« und findest dann keine Anhaltspunkte im Sachverhalt. Du schreibst Quatsch wie »So liegt der Fall hier« und hast letztlich nichts geleistet.
Gesetze beruhen auf Normalfällen
Ein weiteres Argument: Unsere Gesetze beruhen nicht auf Spezialproblemen, sondern auf alltäglichen, praxisrelevanten Fällen. § 303 StGB zur Sachbeschädigung wurde nicht geschaffen, weil jemand mal mit Edding einen Briefkasten beschriftet hat; er wurde geschaffen, weil jemand eine Fensterscheibe eingeschlagen hat.
Wenn du von solchen Normalfällen aus argumentierst, arbeitest du also mit der Gesetzeslogik – und deine Argumentation ist immer vertretbar.
Und jetzt?
Überleg dir ehrlich: Denkst du in und arbeitest bereits mit tatsächlich einfachen Fällen – oder versuchst du noch, dich durch unzählige Probleme zu kämpfen? Wenn letzteres zutrifft: Warum? Warum tust du dir das an?
Wenn du mehr zum Thema dieser Ausgabe lernen willst, empfehle ich dir unseren Online-Kurs 100 % vertretbar: in drei Schritten zur souveränen Lösung jedes Klausurproblems. Zwei Stunden Laufzeit und alles dreht sich um tatsächlich einfache Fälle. Hol dir ein Probeabo unserer Lernplattform endlich jura. All-Access und ackere dich durch die Videos. Keine esoterischen Weisheiten, sondern konkrete Tipps, die du sofort in deinen (Argumentations-) Alltag integrieren kannst. Du findest alle Infos auf endlich-jura.de/all-access.
Fazit
Die besten Examenskandidat*innen sind nicht diejenigen, die alle Probleme kennen – sondern diejenigen, die von der Norm ausgehend den Fall durchdringen. Arbeite also mit der Norm und ihrem Normalfall. Und wenn du magst, diskutieren wir das direkt weiter – in unserer Community »endlich jura. Inner Circle«, enthalten in jedem All-Access-Abo:
YouTube-Video
Schon in den Anfängen des Jura-Studiums wird immer wieder der Eindruck vermittelt, dass es im Examen essenziell sei, Probleme auswendig gelernt zu haben, um sie dann abrufen zu können. Neben dem Fakt, dass es Tausende Probleme gibt, ist es auch einfach ineffizient, sich all diese in sein Gedächtnis zu hämmern. Denn Jura beherrschen bedeutet nicht Auswendiglernen im großen Stil, sondern ist primär eine Frage der Technik.
#examensrelevant