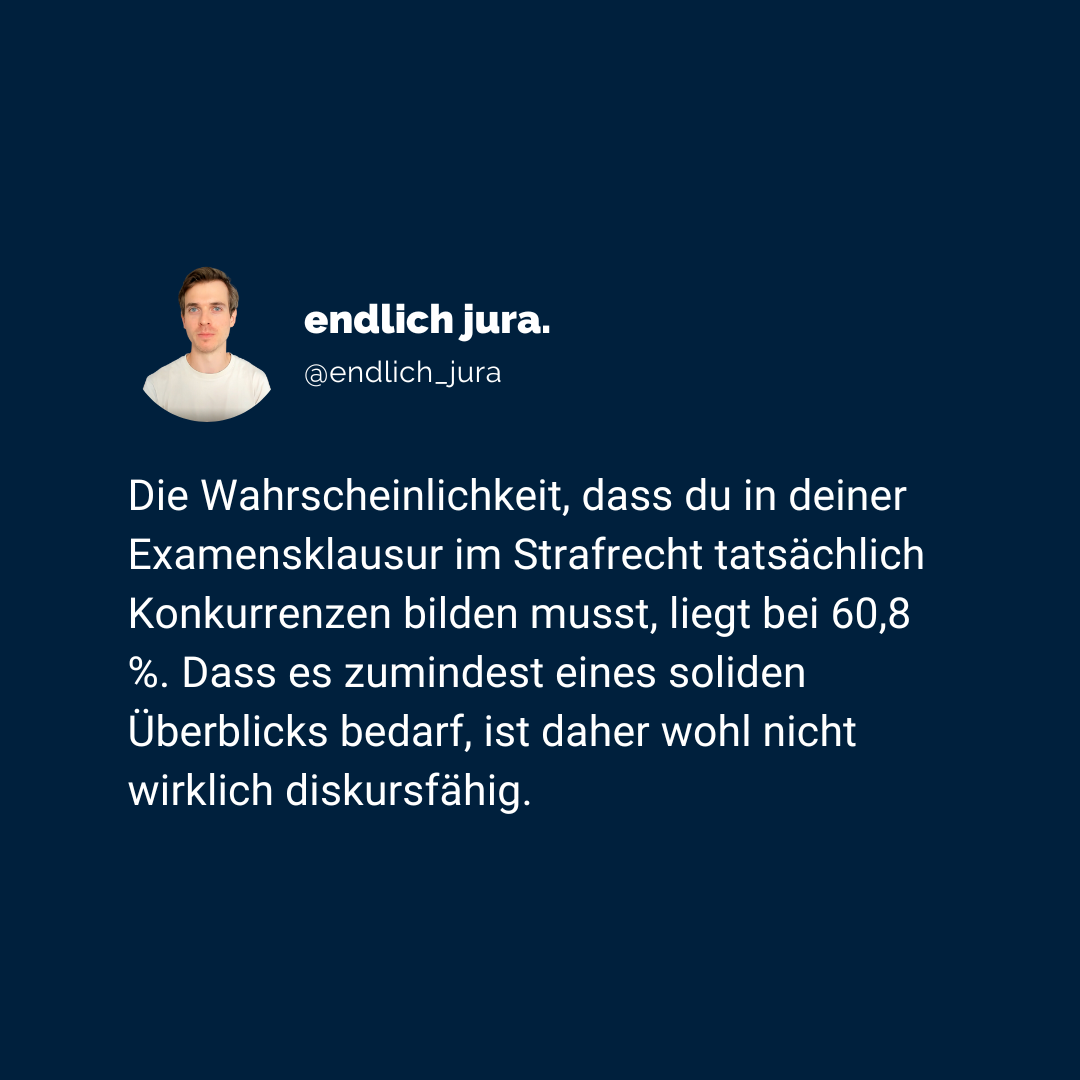JNG #316: Alles zu Konkurrenzen in 3 Minuten (oder weniger)

Lesezeit: 3 Minuten
Konkurrenzen verpassen deiner Klausur den letzten Schliff. Selbst wenn du in einer Klausur einiges nicht optimal bearbeitet hast, kannst du Korrektor*in mit einer soliden Konkurrenzprüfung mit einem guten Gefühl ins Votum schicken.
Warum? Weil du dich allein dadurch von zahlreichen anderen Bearbeitungen abhebst, dass du überhaupt eine Konkurrenzprüfung vornimmst. Viele Studierende verzichten aus Angst, weitere Fehler zu machen, vollständig auf eine Konkurrenzprüfung – und das kann nicht die Lösung sein.
Diese Ausgabe wird präsentiert von endlich jura. All-Access – der Nr. 1 Lösung für dein Jura-Studium.
Warum lohnt es sich, Mitglied bei uns zu werden?
✔ Zugriff auf 60+ Original-Examensklausuren mit Lösung
✔ Jeden Monat zwei neue interaktive Fallbesprechungen
✔ Möglichkeit, deine Fragen direkt in der wöchentlichen Sprechstunde zu klären
Mach es dir nicht so schwer! Teste All-Access jetzt kostenlos – vielleicht können wir ja auch dich unterstützen!
Drei Hinweise vorweg:
-
Tatbestandsverwirklichungen, nicht Delikte: Es treten nicht Delikte (also nicht einzelne Paragrafen), sondern Tatbestandsverwirklichungen in Konkurrenz zueinander. Du schreibst also: Die Verwirklichung des Tatbestands aus § X tritt hinter der aus § Y zurück.
-
Keine Tateinheit oder Tatmehrheit: Tateinheit (§ 52 StGB) und Tatmehrheit (§ 53 StGB) sind keine Formen der Gesetzeskonkurrenz. Sie werden erst geprüft, wenn festgestellt wurde, dass gerade keine Gesetzeskonkurrenz vorliegt.
-
Umstritten, aber pragmatisch: Alles, was ich dir hier erkläre, ist in der Literatur umstritten. Aber Konkurrenzfragen sind selten der Ort für große Streitstände. Ziel ist, dass du eine solide Konkurrenzprüfung hinbekommst und duch dadurch abhebst.
Die drei Fälle der Gesetzeskonkurrenz
Wir unterscheiden grundsätzlich drei Fälle:
-
Spezialität
-
Materielle Subsidiarität
-
Konsumtion
Spezialität
Definition: In der Verwirklichung eines Tatbestands ist der Unrechtsgehalt eines anderen Tatbestands bereits enthalten.
Typische Konstellationen:
-
Qualifikationsverhältnis: Ein Delikt baut auf einem Grunddelikt auf. Beispiel: Wenn du Mord (§ 211 StGB) bejahst, tritt Totschlag (§ 212 Abs. 1 StGB) im Wege der Spezialität zurück – jedenfalls nach einer verbreiteten Auffassung.
-
Zusammengesetzte Delikte: Ein Tatbestand setzt sich aus mehreren kleineren Delikten zusammen. Beispiel: Die räuberische Erpressung (§ 255 StGB) enthält zwingend eine Nötigung (§ 240 StGB). Verwirklichst du § 255 StGB, tritt § 240 Abs. 1 StGB zurück.
-
Sonstige Fälle von Spezialität: Das sind solche, die weder der Kategorie Qualifikation noch der der Zusammensetzung zugeordnet werden können. Beispiel: Falsche Verdächtigung (§ 164 Abs. 1 StGB) verdrängt Verleumdung (§ 187 StGB), weil in der falschen Verdächtigung immer auch eine ehrverletzende Äußerung liegt.
Formelle Subsidiarität: Wenn das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dass ein Tatbestand hinter einem anderen zurücktritt (z. B. § 316 Abs. 1 StGB im Verhältnis zu § 315c StGB), handelt es sich ebenfalls um einen Fall der Spezialität, der aber gesetzlich geregelt ist.
Materielle Subsidiarität
Definition: Typischerweise (aber nicht zwingend) wird durch die Verwirklichung eines Delikts auch ein anderes Delikt verwirklicht, dessen Verwirklichung jedoch zurücktritt.
Typische Beispiele:
-
Sachbeschädigung beim schweren Diebstahl: Beim Einbrechen kann eine Sachbeschädigung entstehen. Tritt sie ein, wird sie von § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB verdrängt.
-
Sachbeschädigung bei einer Schlägerei: In der Beteiligung an einer Schlägerei (§ 231 Abs. 1 StGB) kann eine gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) enthalten sein.
Konsumtion
Definition: Auch hier geht eine Tatbestandsverwirklichung vollständig in einer anderen auf. Man unterscheidet:
-
Mitbestrafte Vortat: Ein Delikt wird begangen, um ein schwereres Delikt vorzubereiten.
-
Mitbestrafte Nachtat: Nach der Haupttat wird ein weiteres Delikt verwirklicht, dessen Unrechtsgehalt bereits im ersten Delikt (= der Haupttat) enthalten ist.
Beispiele:
-
Mitbestrafte Vortat: Wer in eine Wohnung einbricht, um einen Raub zu begehen (§ 249 Abs. 1 StGB), verwirklicht § 123 Abs. 1 StGB, der aber im Schuldspruch nicht erscheint.
-
Mitbestrafte Nachtat: Wer nach einem besonders schweren Diebstahl (§§ 242 Abs. 1, 243 StGB) die gestohlene EC-Karte für einen Computerbetrug (§ 263a Abs. 1 StGB) nutzt, begeht möglicherweise eine mitbestrafte Nachtat.
Zugestanden: Letzteres kann man auch ganz anders – oder gar umgekehrt – sehen.
Zusammenfassung
Du solltest folgende Unterscheidungen beherrschen:
-
Spezialität: Der Unrechtsgehalt des einen Tatbestands ist vollständig im anderen enthalten (z. B. Qualifikation, zusammengesetzte Delikte, formelle Subsidiarität).
-
Materielle Subsidiarität: Typischerweise liegt eine weitere Tatbestandsverwirklichung vor, die aber zurücktritt.
-
Konsumtion: Eine Tatbestandsverwirklichung geht in einer anderen auf – entweder als mitbestrafte Vor- oder Nachtat.
Passendes YouTube-Video
Lassen sich keine passenden Konkurrenzen bilden, sind die §§ 52 f. StGB anzuwenden (und auch richtig zu benennen). Der Gesetzeswortlaut ist auf den ersten Blick irreführend und erzählt auch nicht die ganze Wahrheit.
#examensrelevant